Plaudereien über die Saga: Hintergründe ... Planungen ... Quellen ... Privates ... Mythologien ... Fakten ... Inspirationen ... Anekdoten.

KI-Fantasie-Quetzal.

Ford Falcon in den Anden. KI-Szenenbild aus der Saga.
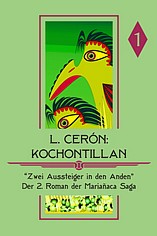
Cover von Kochontillan 1 mit dem Motiv Vögel von Jolly Daubs.

Red Hook, New York, Trockendock an der Van Brunt Street, Wikimedia Commons.

Libelle in mexikanischer Landschaft. KI-Szenbild aus der Saga.

Sabino Canyon, Arizona, USA, Wikimedia Commons.

Hillside, Arizona. KI-Szenenbild aus der Saga.

Dodge D 600 Vintage in Mexiko. KI-Szenenbild aus der Saga

Wildwest in Arizona, KI-Szenenbild aus der Saga.

Phoenix, Arizona, Wikimedia Commons.
Kommen wir zum Mythos Aussteiger und der Frage, warum ich meinen Road Trip Kochontillan schrieb. Kurz: Ich wollte selbst einen lesen. Allerdings mal ganz anders, ohne die gängigen Klischees eines heldenmütigen Weltenbummlers, der immer weiss, wo es lang geht, und der auch genug Geld hat.
Somit erfand ich meine eigenen liebenswerten, mittellosen, optimistischen Vagabunden, Traumtänzer, Glücksucher. Die beiden gründen eine Zweckgemeinschaft. Neal wohnt im Auto. Plutarco kennt sich in Peru aus und wohnt nun mit im Auto.
Zuerst versuchen sie zu jobben, doch das wird schnell langweilig. Außerdem will sie keiner, weil sie keine Arbeitsmoral haben und nichts können. Also stehlen sie alles, was nicht angenietet ist. Diebische Mäuse eben.
Ansonsten lassen sie sich in die Tage treiben und bestätigen sich in enthusiastischen Dialogen gegenseitig in ihrem (Nichts-)Tun.
Mir gefiel die Leichtigkeit und Dramatik. Das Szenario bot mir zudem Möglichkeiten, die Grenzen ihrer Freiheit bis zum Anschlag auszuloten. In letzter Konsequenz schaffte ich in der Saga den Mythos Aussteiger ganz ab.
Aber betrachten wir meine Schelmenromane Kochontillan und Çaçañan einmal aus anderer Sicht. Das Thema Aussteiger, also freiwillig oder unfreiwillige Ausgestossene, öffnete mir eine ungeahnte Bandbreite, um mir persönliche Miseren der Protagonisten auszumalen.
Da ist das fiebrige Umherstreifen auf der Suche nach Beute - also Essen oder Geld oder Jobs - frierend, nass, verzweifelt, radikal. Das gehört zu den alltäglichen, persönlichen Dramen, die literarisch gerne in Trunksucht gebadet werden. Aber mit der Trunksucht ist das so eine Sache, denn dazu gehört Geld.
Ist dafür wirklich Platz „unter freiem Himmel” in Peru? Manchmal ja, aber wohl nicht dauernd.
Als ich die beiden Aussteiger-Romane final ausarbeitete, hatte ich die Bilder vom Wiener Praterstern vor Augen, die nächste U-Bahn-Station an meiner Wohnung. Echte Obdachlose und Kriegsversehrte, die im Praterpark schliefen. Betrunkene auf U-Bahn-Böden, Notarztwagen, dubiose Rempeleleien von alten Männern, die nicht bei Sinnen waren.
Und dann diese beiden jungen Ost-Männer. Der eine lief auf Krücken und hatte ein lahmes Bein, das er ans andere Beine festband. Und trotzdem stolperte er andauernd und fiel hin.
Ich sah diese Menschen und ihre Mienen. So konnte ich in diese Romane ein anderes Lebensgefühl packen: Das der echten Verzweiflung. Und die Gemütsstimmung dahinter: Der rasche Wechsel zwischen Absturz und Optimismus. Diese Wechselseitigkeit verstärkt den Eindruck, wie sehr meine Vagabunden in ihrem rauen Straßenleben gefangen sind.
Die Themen Aussteiger, Gesellschaft und Politik hängen eng zusammen. Hier ist es gesellschafter Druck, dort ist es wirtschaftspolitischer Zwang oder auch eben persönliche Desaster. In Südamerika waren/sind die Repressionen endlos. Minen, Umweltzerstörung, Kartelle und Grossgrundbesitzer. Landvertreibungen in Kolumbien. Diktaturen. Gewalt in den Slums.
Natürlich ließ ich es mir nicht nehmen, dass meine beiden Aussteiger aus Kochontillan und Çaçañan darüber wettern, dass sie persönlich in die tiefsten Höllen des Zerberus gerissen werden. Auf ihrer Reise - die ein kategorischer Ausstieg aus der Gesellschaft ist - blieben sie stets auf der Suche nach sich selbst.
Im Kapitel Domino Effekt in Çaçañan habe ich die versuchte Selbstfindung des Protagonisten thematisiert.
Meine Aussteiger stranden in einem Slum in Bogotà, Kolumbien. Neal fühlt sich in einer Zeitschleife des Misserfolgs gefangen. Um sich abzulenken, stiehlt er aus der Bücherei ein Buch von Thomas Hobbes. Von dessen philosophischer Schrift erhofft sich eine bessere Sicht auf seine eigene Logik, irgendeine Erkenntnis zumindest.
Vor seiner Slumhütte sitzend, grübelt er - ich finde für mich - auf amüsante Weise eine philosophische These, die er von Hobbes ableitet:
• Ein Mensch lebt. Ein Stein lebt nicht.
• Folglich: Ein Stein ist kein Mensch
• oder: Ein Mensch ist kein Stein.
Daraufhin stellt er seine eigene These auf.
• Wenn ich Bürger bin, kenne und achte ich die Gesetze.
• Wenn ich Anarchist bin, kenne und verachte ich die Gesetze.
• Ich kenne keine Gesetze, denn ich lebe gesetzlos.
• Folglich bin ich weder Bürger noch Anarchist.
• Und deswegen weiß ich auch nicht, was ich denken soll.
• Folglich: Muss ich Bürger werden, um Anarchist zu sein?
Daraufhin stellt er seine eigene These auf. Und das ist erst der Anfang seiner Überlegungen ...
Ich habe an der Szene sehr lange geknobelt, um das zu erzählen, was ich wollte. Es mir leider nicht so geglückt, wie ich mir das wirklich vorstellte und ließ sie einfach so stehen, wie sie war.

Entdecken Sie unsere anderen Künstler:

